Mögliche Texte, die interpretiert werden können (bitte nur EINEN auswählen):
Psalm 5
Psalm 8
Psalm 19
Psalm 23
Psalm 24
Psalm 29
Psalm 93
Psalm 121
Psalm 137
(Psalm 145)
____________
Nebenfächler:
Jerusalem in den Psalmen
Gottes Erscheinungen in den Psalmen
Arme und Kranke in den Psalmen
![]()
Literaturtipps zum Verfassen der Arbeit
ZIEL: Die Proseminararbeit soll zeigen, dass ihr Verfasser / ihre Verfasserin in der Lage ist, einen Bibeltext methodisch reflektiert zu interpretieren und die Ergebnisse dieser Interpretation in einer wissenschaftlichen Form zu präsentieren. Zum Nachweis der Fähigkeit wissenschaftlichen Arbeitens gehört die Fähigkeit, Hilfsmittel, Sekundärliteratur und Internet sinnvoll zu nutzen und verschiedene Positionen miteinander ins Gespräch zu bringen sowie die Fähigkeit, eine schriftliche Arbeit formal korrekt zu verfassen.
Umfang:
ca. 33 000 Zeichen (incl. Fussnoten) (ca. = 15 Din-A-4 Seiten)
Formatierung:
Haupttext: 12p 1 1/2 zeilig; rechter Rand mind. 5 cm. mit Computer
Fußnoten unten auf jeder Seite
Aufbau der Arbeit:
•
Titelseite:
Titel der Arbeit (eigene Überschrift)
Untertitel: Exegese von … [Text]
Name, Anschrift, Semesterzahl und Studienfächer der Verfasserin/des
Verfassers
• Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln, Unterkapiteln, Exkursen. Mit Seitenzahlen !
• Vorwort (Einführung ins Thema und/oder Begründung der Gliederung und/oder Forschungsstand und/oder methodische Bemerkungen etc. Allgemein gesagt: Was sollte der Leser/die Leserin vorab wissen? Max 2 Din-A-4 Seiten)
• Hauptteil (Wenn die Arbeit mit dem Computer geschrieben wird, bitte die Fußnoten am Ende jeder Seite bringen. Wenn die Arbeit mit Schreibmaschine geschrieben wird, können die Fußnoten auch am Ende der Arbeit nach dem Schlussteil kommen.)
• Zusammenfassung / Schluss (Eine kurze, prägnate Bündelung der Ergebnisse; evtl. eine eigene Position, max. 2 Din-A-4 Seiten).
• Literaturverzeichnis (korrekte und vollständige Angabe aller für diese Arbeit benutzten Literatur – auch der benutzten Textausgaben, Wörterbücher, Grammatiken, etc. – sowie der benutzen Internetseiten. Bitte nur die benutzte Literatur angeben, nicht alle Literatur der Welt zu eurem Thema! Das Literaturverzeichnis kann untergliedert werden in: Quellen (= benutzte Textausgaben); Hilfsmittel (= Lexika, Konkordanzen, Grammatiken, etc.); Kommentare; sonstige Sekundärliteratur; Internet. Innerhalb einer Rubrik sollte die Literatur in alphabetischer Ordnung stehen (nach den Nachnamen). Es ist lehrreich, sich einige Literaturverzeichnisse in anderen Büchern anzuschauen: wie wurde es dort gemacht?
• Wenn nötig: Abkürzungsverzeichnis mit den von euch neu erfunden Abkürzungen. Bitte benutzt die vorhandenen Abkürzungsverzeichnisse (auch für die biblischen Bücher!). Im Literaturverzeichnis muss man am Anfang darauf hinweisen: Die Abkürzungen richten sich nach: …
31. November 2005 (bis dahin bitte in mein Fach bei Frau Burger in der Friedrichstr. 9 legen) (Stipendiaten bitte auf ihre eigenen, evtl.f rüheren Abgabetermine achten.)
Fragestellungen für die Proseminarbeit
Kritische Reflektion über das Vorverständnis
![]() Erste
eigene Übersetzung des Textes
Erste
eigene Übersetzung des Textes
(am Ende der Interpretationsphase sollte eine neue Übersetzung angefertig werden – so wörtlich wie nötig –, in die die Ergebnisse der Interpretation einfließen werden. Nur diese End-Übersetzung sollte der Arbeit präsentiert werden.)
![]() Reflektion
über das Vorverständnis:
Reflektion
über das Vorverständnis:
Was fällt mir beim ersten, (vermeintlich) unvoreingenommen
Lesen des Textes ein: Was freut mich spontan? Was stört/ärgert mich spontan?
Was verstehe ich sofort? Wo ist mir der Text bisher begegnet? Welche Fragen
wirft er auf? Etc. Etc. (Diese subjektive Wahrnehmung, die ich mir bewusst
gemacht habe, sollte danach bei allen folgenden Schritten so weit wie
möglich aussen vor bleiben, damit sie nicht im Hintergrund unsere
Interpretation lenken, ohne dass wir es merken.)
Der Text und seine sprachliche Form
![]() Strukturanalyse
Strukturanalyse
• Wie ist die sprachliche Struktur des Textes? Sind die Sätze verbunden? Wenn ja, wie?
Dabei bedenken: die Einteilung in Sätze und Abschnitte stammt von den Masoreten (8. Jh. d.Z.), die Kapitel- und Verszählung aus dem christlichem Mittelalter (12. Jh.), diese Einteilungen müssen nicht die einzig möglichen sein!
• Hat der Text eine besondere Struktur, ist er z.B. chiastisch oder konzentrisch aufgebaut? Gibt es Inklusionen?
(Erst beobachten, später –in Diskussion mit der Sekundärliteratur – deuten)
![]() Stilanalyse
Stilanalyse
• Überwiegen Verben oder Substantive? (Welchen Effekt für den Text hat dies?)
• Gibt es Dialoge? Welche Inhalte werden dort vermittelt?
• Gibt es Leitwörter? (Was bewirken sie?)
• Kommen Namen vor? Haben sie eine Bedeutung?
• Gibt es Wiederholungen? (Was bezwecken sie?)
• Finden sich rhetorische Mittel im Text (Metaphern, Ellipsen, rhetorische Fragen, etc.) und was bewirken sie?
(Literaturhinweis: Bühlmann, Walter; Scherer, Karl, Sprachliche Stilfiguren der Bibel. Von Assonanz bis Zahlenspruch. Ein Nachschlagewerk, 2. Aufl. Gießen 1994)
• Gibt es auffällige Wörter, besondere grammatische Phänomene, unlogische Folgen, zeitliche Brüche, sachliche Widersprüche; scheinbar Überflüssiges; Inkonsistenzen?
• Gibt es literarische Gattungen, Formen, Formeln oder Floskeln in dem Text? Woran erkennt man sie? Welche Funktion hat dies in diesem Text?
Der Text und sein Inhalt
![]() Erzählanalyse
(in der Regel nicht in poetischen Texten)
Erzählanalyse
(in der Regel nicht in poetischen Texten)
• Wie ist der Text inhaltlich gegliedert? Gibt es Sinnabschnitte? Wodurch entstehen sie? Wie sind sie miteinander verbunden? Gibt es verschiedene Erzähleinheiten und wodurch entstehen sie?
• Gibt es einen Erzählplot? Wie sieht er aus?
• Wechseln Zeiten oder Personen oder Szenen? Wer spricht/handelt/sieht? Wann tritt welche Person auf? Gibt es Personen oder Themen, die spurlos verschwinden oder uneingeführt auftreten?
• Aus welcher Perspektive wird erzählt (point of view)?
• Welche Informationen werden zurückgehalten? Gibt es Aspekte, die der Leser weiß, aber die Personen in der Erzählung nicht? Werden Dinge für den Leser bereits vorweggenommen? Welchen Effekt hat dies?
• Wer ist der "Held" des Textes? (Wie wird dies im Text deutlich?)
• Was ist die Pointe der Erzählung? (Scopus) (Woran wird dies im Text deutlich?)
• Was ist das Hauptthema? Gibt es Nebenthemen?
• Wie ist das Verhältnis von erzählter Zeit und Erzählzeit? Welche Wirkung hat es?
• Gibt es Wiederholungen von Inhalten? Welche Funktion hat die Wiederholung? Ist die zweite Version identisch mit der ersten? Wo sind Unterschiede und warum?
• In welchem größeren literarischen Kontext steht der Text? Ist der zu interpretierende Text eine in sich geschlossene Einheit oder ein Ausschnitt aus einer größeren Einheit? Wenn letzteres, welchen Platz nimmt er innerhalb der größeren Einheit ein?
![]() Motivanalyse.
Motivanalyse.
• Wird die im Text gesagte Sache auch an anderer Stelle im Buch gesagt? Gibt es Unterschiede zu diesen Parallelen?
• Finden sich in dem Text Traditionen oder Motive, die auch sonst im Tanach vorkommen?
• Gibt es Motive im Text, die gemeinorientalisch sind? Werden die Motive in diesem Text in besonderer Weise behandelt oder typisch?
Der Text und seine Geschichte
![]() Wie
ist die textliche Überlieferung des Textes in alten Handschriften,
alten Übersetzungen, alten Drucken, Zitaten? ("Textkritik") (vgl. dazu E.
Tov, Der Text der Hebräischen Bibel. Handbuch der Textkritik, Stuttgart u.a.
1997)
Wie
ist die textliche Überlieferung des Textes in alten Handschriften,
alten Übersetzungen, alten Drucken, Zitaten? ("Textkritik") (vgl. dazu E.
Tov, Der Text der Hebräischen Bibel. Handbuch der Textkritik, Stuttgart u.a.
1997)
![]() Müssen
historische Sachfragen im Text geklärt werden (Sitten, Bräuche,
Gegenstände, historische Umstände, etc.) Werden Orte oder Ereignisse
genannt? Können diese Orte heute lokalisiert werden? Was wissen wir
historisch über die Ereignisse? Steht der Text evtl. im Widerspruch zu dem,
was man aus archäologischer Sicht heute weiß oder sind die Ergebnisse hier
wie dort identisch? (Biblische Archäologie)
Müssen
historische Sachfragen im Text geklärt werden (Sitten, Bräuche,
Gegenstände, historische Umstände, etc.) Werden Orte oder Ereignisse
genannt? Können diese Orte heute lokalisiert werden? Was wissen wir
historisch über die Ereignisse? Steht der Text evtl. im Widerspruch zu dem,
was man aus archäologischer Sicht heute weiß oder sind die Ergebnisse hier
wie dort identisch? (Biblische Archäologie)
![]() Könnte
der Text Spuren einer literarischen Geschichte aufweisen? Die Frage
nach der literarischen Entstehung eines Textes ist nur dann wichtig,
wenn sie zur Interpretation des Textes Wesentliches beiträgt und wenn sie am
Text selbst nachgewiesen werden kann. Nicht vergessen: Ziel der Exegese ist
die Erklärung des Textes wie er uns heute überliefert ist, keine
idealistische Rekonstruktion des Geistesgeschichte Altisraels.
("Literarkritik"; "Überlieferungskritik"; "Redaktionskritik")
Könnte
der Text Spuren einer literarischen Geschichte aufweisen? Die Frage
nach der literarischen Entstehung eines Textes ist nur dann wichtig,
wenn sie zur Interpretation des Textes Wesentliches beiträgt und wenn sie am
Text selbst nachgewiesen werden kann. Nicht vergessen: Ziel der Exegese ist
die Erklärung des Textes wie er uns heute überliefert ist, keine
idealistische Rekonstruktion des Geistesgeschichte Altisraels.
("Literarkritik"; "Überlieferungskritik"; "Redaktionskritik")
• Enthält der Text Indizien auf seine mögliche Entstehungszeit(en)? Wie sicher sind diese Indizien? Wenn die Datierung unsicher ist, sollte sie bei der Interpretation des Textes nicht als Schlüssel fungieren. (Datierung)
Der Text und seine Auslegungsgeschichte
![]() Die
Entdeckungen am Text sollen ins Gespräch gebracht werden mit (ausgewählten)
Kommentatoren aller Zeiten – vom Midrasch über die mittelalterlichen
Ausleger bis zur Gegenwart.
Die
Entdeckungen am Text sollen ins Gespräch gebracht werden mit (ausgewählten)
Kommentatoren aller Zeiten – vom Midrasch über die mittelalterlichen
Ausleger bis zur Gegenwart.
Welche Fragen / Themen / Beobachtungen haben die Kommentatoren beschäftigt? – Wie kommen die Kommentatoren zu ihren Positionen? (Wer waren sie? Was war das Ziel ihrer Auslegung bzw. welches war ihre Fragestellung?) Was ist das Ziel ihrer Interpretation? Was ist die Besonderheit ihrer Interpretation? Wie stehen Sie selbst zu diesen Interpretationen (was macht den Text stark, was ist ihrer meiner nach nicht einsichtig?)
![]() • Spielt der Text in einer
bestimmten Religion oder Gruppe eine besondere Rolle? Wird er liturgisch
verwendet oder ist er ein Belegtext für eine bestimmte Aussage? Falls ja,
wo?
• Spielt der Text in einer
bestimmten Religion oder Gruppe eine besondere Rolle? Wird er liturgisch
verwendet oder ist er ein Belegtext für eine bestimmte Aussage? Falls ja,
wo?
• Hatte der Text oder ein Vers oder Wort des Textes eine besondere Wirkungsgeschichte? Wie konnte es dazu kommen?
• Rückkopplung mit dem eigenen Vorverständnis (siehe erste Frage): in welcher Tradition der Auslegungsgeschichte befindet es sich?
___________________________________________
Diese Leitfragen sind nur eine ganz allgemeine Checkliste, die hilft zu prüfen, ob man nichts Wichtiges vergessen hat. Nicht alle Fragen können auf jeden Text angewendet werden! Die Leitfragen sollen nicht die Kapitel der Arbeit sein! Bitte nur als Checkliste betrachten! Es ist nicht verboten, auch andere Fragen zu stellen, wenn sie sich aus dem Text ergeben!
Es ist ratsam, die Sekundär-Literatur erst nach ersten eigenen Beobachtungen am Text heranzuziehen, um offen zu sein für Fragen des Textes und sich nicht von den Fragen der Literatur dominieren zu lassen. Die Gefahr besteht, dass man Lesefrüchte zusammenschreibt - das ist nicht der Sinn der Sache! Die Sekundärliteratur sind vielmehr Dialogpartner. Sie sollte auf bestimmte Aspekte hin befragt werden. Dabei bitte die jeweils eigenen Positionen der Autoren unbedingt beachten – was war ihnen wichtig? Die Positionen der Literatur sollten in der Arbeit dialogisch-argumentativ präsentiert werden (Lasst die Autoren fiktiv miteinander sprechen).
![]() Wie findet man
sinnvolle Sekundärliteratur ?
Wie findet man
sinnvolle Sekundärliteratur ?
• HEIDI bzw. HJS Katalog, Schlagwörter
• RAMBI
• Literaturanganben in anderer Literatur, vor allem Lexikonartikeln oder Kommentaren oder Literaturverzeichnis von Dissertationen zum Thema, etc.
Überblick über Bibliothekskataloge und Suchmöglichkeiten: hier
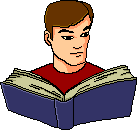
![]() Wie benutzt man
Sekundärliteratur ?
Wie benutzt man
Sekundärliteratur ?
Frage dich:
• Wer ist der Autor/die Autorin des Werkes und was ist SEIN/IHR Anliegen? (siehe Vorwort, Einleitung, Buchinformation, etc.)
• Zu welcher Fragestellung liest du dieses Buch/dieses Artikel? Notiere dir die Thesen, die hier zu deiner Fragestellung vertreten werden.
• Basiert dieses Buch/dieser Artikel auf anderen Werken? Wird hier eine ganz neue These vertreten (und wie begründet)?
• Achte darauf, NEUERE Literatur zu benutzen.
• Lies nie nur ein einziges Werk zu einer Fragestellung. Mindestens drei völlig verschiedene Positionen kennen.
• Frage dich: was ist die Stärke der hier vertretenen These? Was ist die Schwäche? Werte die gelesene Literatur daraufhin aus und beziehe eine eigene Position (anhand von Argumenten im Text).
• Bringe die Ergebnisse dieser Auswertung in die Arbeit an den passenden Stellen ein. Deine Interpretation sollte ein Dialog mit der Sekundärliteratur sein.
![]() Wie
zitiert man
Sekundärliteratur ?
Wie
zitiert man
Sekundärliteratur ?
• Für die Angabe von Literatur gelten in wissenschaftlichen Arbeiten sehr feste Regeln. Hinweise zu korrekten Literaturangaben finden sich hier.
• In der Arbeit werden sie auf Literatur verweisen bzw. aus ihr zitieren. Auch hier gibt es Regeln. Für Hinweise zum korrekten Zitieren siehe hier.
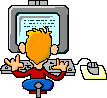 Das
Ausformulieren der Arbeit
Das
Ausformulieren der Arbeit
• Die Leitfragen sind nur Tipps und Hilfen. Es ist nicht verboten, sich nach anderen Leitfragen zu richten!!! (Vgl. z.B. die Arbeitsvorschläge in: Utzschneider, H.; Nitsche, St., Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung, Gütersloh 2001). In einem Vorwort sollte erläutert werden, warum die Hausarbeit in welcher Weise gegliedert wurde, welche Fragen behandelt wurden und evtl. welche nicht und warum nicht.
• Es empfiehlt sich, sich bei der entdeckenden und lesenden Arbeit an den Leitfragen bereits Stichworte zu machen oder sogar einzelne Abschnitte vorläufig (!) zu formulieren, die Endformulierung aber erst anzufertigen, wenn man einen möglichst großen Überblick über die verschiedenen Aspekte des Textes hat. Dann weiß man, wie sich welcher Aspekt auf welchen anderen bezieht.
Nach der Bearbeitung der Leitfragen:
• Am Ende der Interpretation erneut eine Übersetzung des Textes anfertigen. Möglicherweise übersetzt man mit dem angehäuften Wissen jetzt anders. Die Übersetzung eines Textes spiegelt seine Interpretation wieder. Die Übersetzung bitte – wenn nötig – in Fußnoten begründen bzw. auf Kapitel in der Arbeit hinweisen, wo etwas begründet wird.
• Vorab: Gliederung der Arbeit planen (was will ich in welcher Reihenfolge sagen)
• Einzelne Kapitel ausformulieren. Die Ergebnisse und ihre Argumentationsgänge und Begründungen in stilistisch gutem korrekten Deutsch logisch schlüssig darstellen. Die Sekundärliteratur in dialogischer-argumentativer Weise einbringen. Wörtliche Zitate nur dann bringen, wenn das Zitat wichtig für die Argumentation ist und die genaue Quelle des Zitats in einer Fußnote angeben. Wenn man sich sachlich auf die Literatur bezieht oder eine Argumentation aus der Literatur übernommt, verweist man - ohne wörtlich zu zitieren - in der Fußnote auf die Quelle. Das ist überall dann wichtig, wo man Dinge referiert oder sich auf Dinge gründet, die andere bereits ausführlich begründet oder dargestellt haben. In den Fußnoten kann auch eine Argumentation mit der Literatur stattfinden, wenn sie zu unwichtig ist, um in den Haupttext zu kommen, aber dennoch nicht so unwichtig, um übergangen zu werden. Aber: Der Haupttext an sich muss jedoch ohne die Fußnoten eine logische Argumentation sein, muss gut überlegt sein, was in die Fußnoten und was in den Haupttext gehört.
Es kommt übrigens nicht darauf an, Spannung beim Leser zu erzeugen, sondern es geht um die logische Schlüssigkeit der Argumentation, daher macht es sich manchmal gut, die These, um die es geht, vorneweg zu stellen und danach zu begründen. (Es gibt aber auch Fälle, wo es andersherum besser sein könnte.) LOGIK und Schlüssigkeit ist wichtig, nicht Spannung oder Poesie!
• In einem Schlussteil die wichtigsten Ergebnisse der Interpretation bündig zusammenfassen. In längeren Kapiteln macht es sich manchmal auch gut, am Ende eines Kapitels noch einmal ein Fazit des Ganzen zu bringen. (Aber aufpassen: nicht redundant werden! Eine wissenschaftliche Arbeit ist das Gegenteil von einer didaktischen Präsentation - wo man die Dinge mehrfach in verschiedenen Weisen sagen sollte.)
 WICHTIGE
WEITERE HINWEISE:
WICHTIGE
WEITERE HINWEISE:
Eine Proseminararbeit soll nicht die einzelnen Leitfragen beantworten und die Antworten bloß stichwortartig festhalten, sondern eine gut lesbare, überzeugende Interpretation des Textes präsentieren, die diese Aspekte irgendwo (d.h. dort, wo es in Duktus der Interpretation Sinn macht) berücksichtigt. Die Arbeit ist keine Stichwortliste! Sie muss ausformuliert sein - in gutem, fehlerfreien Deutsch.
In der ausformulierten Hausarbeit wird die Sekundärliteratur von Anfang an mit berücksichtigt, auch wenn sie beim eigenen Arbeiten erst später dazu kam.
In die Arbeit können an passenden Stellen auch eigene Positionen eingebracht werden, aber sie müssen gut begründet werden. Alle Schlussfolgerungen müssen gut argumentativ präsentiert werden (am idealsten mittels überzeugender philologischer Beobachtungen am Text selbst in Auseinandersetzung mit den Positionen der Sekundärliteratur).
Es sollte eine sinnvolle Auswahl der wichtigsten Aspekte zur Interpretation des Textes getroffen werden. Es muss nicht alles behandelt werden, was je zu diesem Text gesagt wurde und es kommt nicht auf besonders originelle neue Sichtweisen an. Man muss gut erwägen: Was kann ich in der mir zur Verfügung stehenden Zeit sinnvoll schaffen? Es ist außerdem sehr schwierig, einen Text kurz zu halten. (Es ist viel leichter, 1000 Seiten unkonzentriert daherzulabern!) Daher ist einer der Lerneffekte der Arbeit auch, eine sinnvolle Auswahl auf einer begrenzten Seitenzahl zu präsentieren. Die Arbeit darf aber auch nicht zu kurz sein, als wäre sie nur ein Notizzettel – sie muss so sein, dass die notwendigen Argumentationen zur Begründung von Thesen schlüssig sind und gut lesbar und nachvollziehbar.
Die äußere Form einer wissenschaftlichen Arbeit ist sehr wichtig! Der Verfasser / Die Verfasserin einer Proseminararbeit soll nachweisen, dass er / sie die üblichen Geflogenheiten kennt:
• Eine wissenschaftliche Arbeit wird als Computerausdruck (oder maschinenschriftlich) eingereicht, nicht als Handschrift!
• Die Seitenzahlen sind nummeriert.
• Der Text der Arbeit ist in in jeder Hinsicht fehlerfreiem Deutsch (d.h.: keine orthographischen Fehler, keine Zeichensetzungsfehler, keine Tippfehler, keine grammatischen Fehler, keine syntaktischen Fehler.) Die Arbeit sollte in einem guten deutschen Stil verfasst sein (keine pseudowissenschaftlichen komplizierten Schachtelsätze oder unnötigen Fremdwörter). Die Arbeit sollte formal korrekt sein, d.h.:
• Anmerkungen sind Sätze, dh. Sie beginnen mit einem Großbuchstaben und enden mit einem Punkt.
• Literaturangaben folgen festen Formen (siehe die Beispielseite oder die Beispiele in den Literaturtipps zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten).
• Zitate und Herkunfsangaben von Zitaten in einer Fußnote folgen festen Formen! (dto.) Zitate werden in der Sprache des Originals zitiert. (Bei seltenen Sprachen kann man in einer Fußnote eine Übersetzung bringen.)
Zur Form von wissenschaftlichen Arbeiten siehe Allgemeine Literaturtipps zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten. Besonders zu empfehlen ist (da kurz, billig und inhaltlich gut): Niederhauser, Jürg, Duden. Die schriftliche Arbeit, 3. Aufl. Mannheim u.a. 2000 (4,50).
_____________________________________________________________________
![]() Allgemeine
Literaturtipps zum Verfassen wissenschaftlicher
Arbeiten:
Allgemeine
Literaturtipps zum Verfassen wissenschaftlicher
Arbeiten:
Bünting, Karl; Bitterlich, Axel; Pospiech, Ulrike, Schreiben im Studium, Cornelsen (15,50)
Bänsch, Axel, Wissenschaftliches Arbeiten. Seminar- und Diplomarbeiten, 7. Aufl. München/Wien 1999 (9,80)
Esselborn-Krumbiegel, Helga, Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben, 2. Aufl. Schöningh, (11,90 Euro)
Frank, Norbert; Stary, Joachim, Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, 11. Aufl. (UTB) Schöningh (17,90 Euro)
Franck, Norbert, Handbuch Wissenschaftliches Arbeiten (Fischer Tb 15186), Frankfurt (Main) 2004 (9,90)
Grundwald, Klaus; Spitta, Johannes, Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen zu Herangehensweisen, Darstellungsformen und Regeln, Frankfurt (Main) 1997 (5,-)
Jele, Harald, Wissenschaftliches Arbeiten: Zitieren, München/Wien 2003 (17,80)
Seidenspinner, Gundolf, Wissenschaftliches Arbeiten. Techniken, Methoden, Hilfsmittel, Aufbau, Gliederung, Gestaltung, richtiges Zitieren, 9. Aufl. München 1994 (6,95)
Theisen, Manuel R., Wissenschaftliches Arbeiten, 3. Aufl. München 1989 (13,-)
Nicol, Natascha; Albrecht, Rolf, Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Word (24,95)
Niederhauser, Jürg, Duden. Die schriftliche Arbeit, 3. Aufl. Mannheim u.a. 2000 (4,50) [empfehlenswert !!]
Pyerin, Brigitte, Kreatives wissenschaftliches Schreiben. Tipps und Tricks gegen Schreibblockaden, Weinheim/München 2001 (12,-)
![]() zu
den Methoden der wissenschaftlichen
Bibelinterpretation
zu
den Methoden der wissenschaftlichen
Bibelinterpretation
Adam, Gottfried, Einführung in die exegetischen Methoden, Gütersloh 2000
Alter, Robert, The Art of Biblical Narrative, 1981
Alter, Robert, The Art of Biblical Poetry, Edingurgh 1990
Amit, Yairah, Reading Biblical Narratives. Literary Criticism and the Hebrew Bible, Minneapolis, MN 2001
Bar-Efrat, Shimon, Narrative Art in the Bible, Sheffield 2000
Bechtoldt, Hans-Joachim, Die jüdische Bibelkritik im 19. Jh., Stuttgart u.a. 1995
Berlin, Adele, The Art of Biblical Poetry, Bloomington and Indianopolis 1991
Fokkelman, Jan P., Reading Biblical Narrative. An Introductory Guide, Leiderdorp/Louisville, Kentucky 1999
Fokkelman, Jan P., Reading Biblical Poetry. An Introductory Guide, Louisville 2001
Knight, Douglas A., Methods of Biblical Interpretation, Nashville 1999
Kraus, Hans-Joachim, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des alten Testaments, Neukirchen-Vluyn 1956
Loretz, Oswald, Psalmenstudien. Kolometrie, Strophik und Theologie ausgewälter Psalmen (BZAW 309), Berlin 2002
Meuer, Thomas, Einführung in die Methoden alttestamentlicher Exegese, Münster u.a. 1999
Radday, Yehuda, Auf den Spuren der Parascha. Ein Stück Tora zum Lernen des Wochenabschnitts, 7 Bde Frankfurt 1989ff
Schreiner, Josef, Einführung in die Methoden der biblischen Exegese, Würzburg 1971
Seybold, Klaus, Poetik der Psalmen (Poetologische Studien zum Alten Testament 1), Stuttgart 2003 (Standardwerk !)
Steck, Odil Hannes, Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik; ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 14. Aufl. Neukirchen-Vluyn 1999
Tanner, Beth LaNeel, The book of Psalms through the lens of intertextuality (Studies in Biblical Literature 26), New York u.a. 2001
Tov, Emanuel, Der Text der Hebräischen Bibel. Handbuch der Textkritik, Stuttgart u.a. 1997 (Standardwerk)
Utzschneider, Helmut; Nitsche, Stefan Ark, Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001
Würthwein, E., Der Test des Alten Testaments, 5. Aufl. Stuttgart 1988 (in unserem App.)
Hilfmittel zum hebräischen Text
(siehe mehr auf: www.annette-boeckler.de/arbeitsmittel/seminarbibel_hilfsmittel.html)
![]() Konkordanzen (Auswahl):
Konkordanzen (Auswahl):
Even-Shoshan, Abraham, A New Concordance of the Old Testament, Grand Rapids 1989
Even-Shoshan, Abraham, A New Concordance of the Bibel: thesaurus of the language of the Bible, Hebrew and Aramaic, roots, words, proper names, phrases and synonyms, Jerusalem 1977 (hebr.)
Mandelkern, Solomon, Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae, Graz 1896
ComputerProgramme, die als Konkordanz benutzt werden können:
Accordance 6.3; Oak Tree Software, Juli 2004 (für Macs)
Bible Works 4, The Premier Biblical Exegesis and Research Program, 4.0, 1996 (für Windows)
![]() Wissenschaftliche Lexika zum Hebräisch
des Tanach (Auswahl):
Wissenschaftliche Lexika zum Hebräisch
des Tanach (Auswahl):
Brown, Frances; Driver, Samuel Rolles; Briggs, Charles A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford 1957
Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, bearb. von Frants Buhl. Unverändert. Neudr. der 1915 ersch. 17. Aufl., Berlin u.a. 1962
Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Bearb. und hrsg. von Rudolph Meyer u.a., 18. Aufl. Berlin seit 1987 (bisher nur einzelne Lieferungen erschienen)
Koehler, Ludwig; Baumgartner, Walter, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 3. Aufl. neu bearb. von Walter Baumgartner; Johann Jakob Stamm, 5. Bände Leiden 1967-1995
Zorell, Franz, Lexicon Hebraicum et Aramaicum Veteris Testamenti; Quod aliis collaborantibus ed. Franciscus Zorell, Rom 1956
Übrigens: Um sich die Bedeutung eines Wortes oder einer Wendung zu erschließen, ist oft auch ein Blick in ältere Lexika anregend bzw. in mittelalterliche und moderne Kommentare, Übersetzungen und vor allem in die Konkordanz!
![]() Wissenschaftliche Grammatiken Hebräisch
des Tanach (Auswahl)
Wissenschaftliche Grammatiken Hebräisch
des Tanach (Auswahl)
Gesenius, Wilhelm; Kautzsch, Emil, Hebräische Grammatik, 28. Aufl. Leipzig 1909 (Nachdr. Hildesheim 1985) (Achtung: heute zum Teil veraltet)
Joüon, Paul, A Grammar of Biblical Hebrew, translated and revised by Takamitsu Muraoka, 2. Bde., Rom 2000 (sehr empfehlenswert !)
Meyer, Rudolf, Hebräische Grammatik. Mit einem bibliographischen Nachwort von Udo Rüterswörden, Berlin 1992
Waltke, Bruce; O'Connor, Michael, An Introduction to Biblical Hebrew Syntay, Winona Lake, Ind. 1990
![]() Nachschlagewerke zu verschiedenen
Bereichen (Auswahl)
Nachschlagewerke zu verschiedenen
Bereichen (Auswahl)
Ashkenazi, Sh./Jarden, D., Ozar Rashe Tevot. Thesaurus of Hebrew Abbreviations, Jerusalem 1998
Bühlmann, Walter; Scherer, Karl, Sprachliche Stilfiguren der Bibel. Von Assonanz bis Zahlenspruch. Ein Nachschlagewerk, 2. Aufl. Gießen 1994
Encyclopaedia Judaica, 16 Bde., Jerusalem 1971ff
Freedman, David Noel (Hg.), The Anchor Bible Dictionary, 6 Bde, New York.NY 1992
Hyman, Aharon, Torah Hakethubah Vehamessurah. A Reference Book of the Scriptural Passages quoted in Talmudic, Midrashic and Early Rabbinic Literature, 3 Bände, 2. Aufl. Tel Aviv 1979
Keel, Otmar; Küchler, Max; Uehlinger, Christoph, Orte und Landschaften der Bibel. Ein Handbuch und Studienreiseführer zum Heiligen Land, 5 Bde. Zürich 1984ff
Pinney, Roy, The Animals in the Bible. The Identity and Natural History of all the animals mentioned in the Bible, Philadelphia 1964
Schouten van der Velden, Adriaan, Tierwelt der Bibel, Stuttgart 1992
Weippert, Helga, Palästina in vorhellenistischer Zeit (Handbuch der Archäologie 2,1), München 1988
Zohary, Michael, Pflanzen der Bibel. Vollständiges Handbuch, Stuttgart 1983
sehr gut (1): eine Leistung, die den Erwartungen entspricht und überdurchschnittliche Qualität hat.
gut (2): eine Leistung, die den Erwartungen rundum entspricht. Kleine Flüchtigkeitsfehler sind erlaubt.
befriedigend (3): eine Leistung, die zwar den Erwartungen entspricht, aber Fehler enthält, die leicht behoben werden könnten.
ausreichend (4): eine Leistung, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entspricht, aber größere oder grobe Fehler enthält, die aber behoben werden könnten.
mangelhaft (5): eine Leistung, der erhebliche Mängel aufweist, die nicht passieren dürften. Es wäre gut, diese Arbeit völlig neu zu wiederholen.
ungenügend (6): eine nicht erbrachte Leistung
Folgend Aspekte einer Arbeit werden je einzeln zensiert:
Literaturverzeichnis
(formale Richtigkeit; Qualität der Literaturrecherche)
Anmerkungen
(formale und sachliche Richtigkeit; wurden Zitate korrekt zitiert und
sachlich sinnvoll eingebracht?)
Übersetzungen (bei
mehreren Texten Einzelnoten)
(lexikalisch und grammatikalisch korrekte Widergabe des Textes in korrektem
Deutsch)
Äußere Gestaltung
(formale Richtigkeit; Übersichtlichkeit; korrektes Deutsch; Seitenzahlen
vorhanden?; Inhaltsverzeichnis formal korrekt?)
Gliederung der
Arbeit
(überzeugend und logisch hierarchisch
gegliedert? Inhaltlicher Aufbau)
Analysen (Argumentation; Textkritik; Gliederung des Textes; Historische Methoden; Literaturwissenschaftliche Methoden; Umgang mit Sekundärliteratur; sachliche Richtigkeit)
Gesamteindruck/besondere Pluspunkte, z.B. korrekt eingebrachte exegetische Eigenständigkeit oder Kreativität, besonders gute Ideen, etc.
Die Gesamtnote der Arbeit ergibt sich aus der Quersumme der Einzelnoten.

